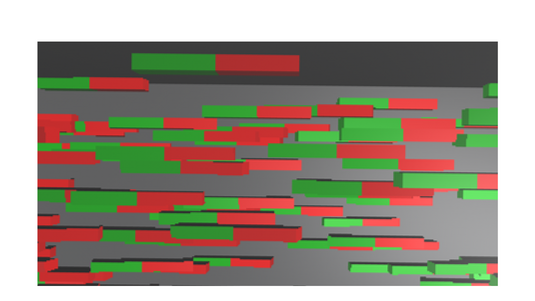Gleichtakt im ultrakalten Quanten-Orchester
Roland Wengenmayr

Den Nobelpreis für Physik 2001 erhielten ein deutscher und zwei amerikanische Physiker für Pionierarbeiten zur „Bose-Einstein-Kondensation“. Die Wissenschaftler erforschen ultrakalte Gaswolken, deren Atome den gleichen „Quantenzustand“ besetzen.
Forscher des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching lieferten schon mehrfach wichtige Beiträge zu diesem faszinierenden Forschungsgebiet. Wie der Laser könnten Bose-Einstein-Kondensate die Entwicklung völlig neuer Technologien anstoßen.
„Eigentlich dürfte es Bose-Einstein-Kondensate gar nicht geben“, scherzt Johannes Schuster. Er ist Doktorand in der Forschungsgruppe von Gerhard Rempe, dem Geschäftsführenden Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching. Schuster denkt an die Konsequenzen der Thermodynamik, also der Wärmelehre. Bose-Einstein-Kondensate sind Ensembles ultrakalter Atome mit besonderen Quanteneigenschaften. Nach den Gesetzen der Thermodynamik dürften diese ultrakalten Gaswolken nicht existieren: Sie müssten in eine Flüssigkeit kondensieren oder einen festen Körper ausfrieren. Trotzdem gelang es Wissenschaftlern im Jahr 1995 mit einer hoch entwickelten Technologie zum ersten Mal, ein Bose-Einstein-Kondensat herzustellen. Diese exotische Form der Materie blieb sogar für viele Sekunden stabil, bevor sie der thermodynamische Tod ereilte.
Drei Physiker, darunter ein Deutscher, erhielten für ihre Pionierarbeit über Bose-Einstein-Kondensate den diesjährigen Nobelpreis für Physik. Doch was sind Bose-Einstein-Kondensate - oder BEC (vom englischen „Bose-Einstein-Condensate“), wie sie die abkürzungsfreudigen Physiker nennen? Warum sind sie so wichtig? Eine Antwort gibt Theodor W. Hänsch. Der Direktor der Abteilung Laserspektroskopie am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist einer der Väter dieses jungen Forschungsgebiets. Aus seiner Sicht bieten Bose-Einstein-Kondensate eine wunderbare Möglichkeit, wichtige Experimente zum „Welle-Teilchen-Dualismus“ zu machen. Diese Eigenschaft der Materie, die aus der Quantenmechanik resultiert, muss jeder Physikstudent erst einmal verdauen. Materie zeigt nämlich zwei Verhaltensweisen: Die einer Welle und zugleich die eines Teilchens. Bose-Einstein-Kondensate erlauben es auf einzigartige Weise, „in einem Grenzgebiet zu experimentieren, wo wir entweder den Wellen- oder den Teilchencharakter in den Vordergrund rücken“, so Hänsch. Und: „Damit können wir unser Verständnis der Quantenmechanik trainieren.“
„Bose-Einstein-Kondensate verdanken ihre Existenz allein der Ununterscheidbarkeit quantenmechanischer Teilchen“, steckt Gerhard Rempe das Spielfeld ab. Das Verhalten von Atomen in einem BEC erinnert an das bestimmter Mitglieder eines Symphonieorchesters - etwa aller Violinisten, die exakt dieselbe Melodie spielen. Diese Musiker „schwingen“ im Gleichtakt. In einem BEC besetzen gleichartige Atome wie zum Beispiel Natrium gemeinsam den Quantenzustand mit der niedrigstmöglichen Energie, den „Grundzustand“. Hier sorgt eine „Materiewelle“ für den Gleichtakt der Atome. Nun soll die stimmführende erste Geigerin mit einem ihrer Kollegen den Platz tauschen. Weil die beiden Musiker hoch spezialisierte Individuen sind, verändert das sofort den Gesamtklang der Streichergruppe. Tauschen hingegen zwei gleichartige Atome ihren Platz innerhalb eines Quantenzustands, dann passiert - absolut nichts! Atomen fehlen nämlich von Natur aus jegliche individuellen Eigenschaften, sie sind ununterscheidbar.
Diese Eigenart der Quantenwelt hat Konsequenzen, auf die schon Mitte der zwanziger Jahre der indische Physiker Satyendranath Bose stieß. Gemeinsam mit Albert Einstein entwickelte er für die nach ihm benannten Bosonen, zu denen auch viele Atome gehören, eine neue Quantenstatistik. Eine Konsequenz dieser Quantenstatistik war ein merkwürdiges Verhalten: Knapp über dem absoluten Temperaturnullpunkt (bei minus 273 Grad Celsius) sollten gleichartige Bosonen dazu neigen, gemeinsam in einen quantenmechanischen Grundzustand zu „kondensieren“.
Ein Millionstel Grad über dem Nullpunkt
Damit Atome ein BEC bilden können, müssen sie auf Temperaturen unterhalb eines Millionstel Grad Celsius über dem Nullpunkt abgekühlt werden. Wie erreicht man eine solche Ultrakälte im Labor? In den siebziger Jahren schlugen Theodor W. Hänsch und andere Forscher vor, zum Kühlen der Atome Laserlicht einzusetzen. Wenn das Licht richtig präpariert ist, übt es auf die Atome einen „Lichtdruck“ aus und bremst sie ab. Das Abbremsen kühlt die Atome, weil die Wärme ihrer Bewegungsenergie entspricht.
In den achtziger Jahren entstand aus dieser ersten Idee schließlich die „magnetooptische Falle“ (MOT). Die Abbildung zeigt stark vereinfacht ihren Aufbau: Sie besteht aus mindestens sechs Laserstrahlen, von denen je zwei einander entgegenlaufen (rote Pfeile). Die Laser sind so angeordnet, dass das Atom (blaue Kugel) entlang jeder Raumrichtung abgebremst wird. Die MOT kann auf diese Weise eine Wolke aus mehreren Milliarden Atomen kühlen. Außerdem produzieren zwei elektrische Spulen (kupferfarben) ein Magnetfeld. Zusammen mit den Lichtkräften schiebt dieses Feld die gebremsten Atome in den Kreuzungspunkt der Laserstrahlen und hält sie dort fest. Dann wird das Laserlicht abgeschaltet und die Gaswolke in einer rein magnetischen „Falle“ gefangen. Die Idee zum letzten Kühlschritt kam den Physikern vielleicht beim Kaffeetrinken: Eine schwache Radiowelle „bläst“ die heißesten Atome der Gaswolke weg. Diese „Verdampfungskühlung“ sorgt dafür, dass die restlichen Atome in der Falle in ein BEC kondensieren.
Bose-Einstein-Kondensate eröffnen den Physikern neue Forschungsmöglichkeiten. Hänsch und seine Mitarbeiter beschäftigen sich zum Beispiel mit einer völlig neuen Quelle für Materiewellen - dem Atom-Laser. Er produziert einen Strahl aus Atomen, dessen Eigenschaften an Laserlicht erinnern. Die wichtigste dieser Eigenschaften ist die hohe Kohärenz von Laserstrahlen. Ihre Wellenzüge sind sehr lang, sie bauen sich aus vielen einander abwechselnden Wellenbergen und Wellentälern auf. Hinzu kommt ihre scharfe Frequenz: Laserlicht ist einfarbig. Deshalb kann man Laserstrahlen aufteilen und mit sich selbst so überlagern, dass sie sich teilweise auslöschen oder verstärken. So entstehen beispielsweise Hologramme.
Beim Atomlaser übernehmen Atome die Rolle der Lichtquanten. Sie bilden eine Materiewelle, in der die Atome einen Quantenzustand besetzen. Allerdings braucht ein Atomlaser - anders als ein echter Laser - einen „Vorratsbehälter“, aus dem er seine Materiewelle speisen kann. Dieses Reservoir muss Atome enthalten, die bereits alle in einem Quantenzustand präpariert sind: Genau das bietet ein BEC.
Im Jahr 1998 stellten Hänsch und seine Mitarbeiter Immanuel Bloch und Tilman Esslinger zum ersten Mal einen kontinuierlichen Atomlaserstrahl her. Dazu bohrten sie ein BEC mit einem Radiowellenpuls an. Durch das „Loch“ fielen Atome aus dem Kondensat heraus, weil sie von der Schwerkraft der Erde angezogen wurden. Im Fallen blieben sie eine Weile im Quantenzustand des Kondensats und formten so eine Materiewelle, die sich ausdehnt.
Das Beispiel des Geiger-Ensembles macht das Experiment wieder verständlich. Dazu führt es eine zeitgenössische Musikperformance auf: Während des Stücks verlassen einige Violinisten den Konzertsaal. Sie entfernen sich, ohne dabei das Spiel zu unterbrechen. Die beiden getrennten Musikergruppen können sich noch eine Weile gegenseitig hören und bleiben so im Gleichtakt - also im gleichen Zustand. Mit wachsender Entfernung reißt jedoch die akustische Verbindung ab und der gemeinsame Zustand „zerfällt“. Das passiert auch dem Atomlaserstrahl.
Physiker interessiert nun zum Beispiel, wie weit ein Atomlaserstrahl kommt, bevor diese Kohärenz verloren geht. Dazu manipuliert das Team um Hänsch den Strahl mit Magnetfeldern, die auf ihn wie Spiegel wirken. In einem besonders faszinierenden Versuch sperrten die Münchner Physiker einen Teil des Atomlaserstrahls in einen magnetischen „Resonator“ ein. Die Bildfolge demonstriert eindrucksvoll, wie die Atome wie Perlen an einer Kette zwischen den zwei magnetischen Spiegeln hin- und herlaufen. Solange ihre Messgeräte die Materiewelle verfolgen konnten, haben die Physiker bis zu 35 Reflexionen beobachtet.
„Schauen Sie, hier hängt es“, sagt Jakob Reichel, Postdoktorand in Theodor Hänschs Quantenoptik-Gruppe an der Universität München. Reichel deutet stolz auf eine rechteckige Glaszelle, die nur einige Zentimeter groß ist. Darin glänzt eine etwa briefmarkengroße, verspiegelte Fläche. Hinter ihr verbirgt sich ein Mikrochip, an dessen Entwicklung auch die Doktoranden Wolfgang Hänsel und Peter Hommelhoff beteiligt waren. Der Chip stellt eine technische Revolution in der Herstellung der Bose-Einstein-Kondensate dar: Er erzeugt ein BEC viel einfacher als bisher und erlaubt es obendrein, das BEC einfach zu manipulieren.
Eine herkömmliche MOT hat zwei Nachteile. Sie erzeugt ihr Magnetfeld mit Spulen, die meistens außerhalb der Probenkammer liegen. Um die relativ weit entfernte Atomwolke zu beeinflussen, braucht sie ein unpraktisch starkes Magnetfeld. Deshalb kann sie auch nur simple magnetische Fallen formen. Das beschneidet die Möglichkeiten, das eingefangene BEC zu manipulieren.
Atomfalle auf dem Mikrochip
Der Atomchip bringt nun die Quelle des Magnetfelds möglichst nahe an die Atomwolke. Dabei übernehmen elektrische Leiterbahnen die Funktion der Spulen; sie können bei der Produktion des Chips fast beliebig gestaltet werden und auf diese Weise sehr komplexe Magnetfelder an der Chipoberfläche erzeugen. Durch Umschalten zwischen verschiedenen Leiterschleifen können die Münchner Physiker die Form der magnetischen Falle während des Experiments breit variieren.
Bei der Konstruktion des Atomchips mussten sie jedoch ein prinzipielles Problem lösen: Der Chip würde einen Teil der sechs Laserstrahlen abschirmen, die für den Atomfang nötig sind. Theodor Hänsch nimmt einen Zettel und zeichnet: Bei geschickter Anordnung kann die Chipoberfläche das Laserlicht so spiegeln, dass es eine optische Falle nahe der Chipoberfläche bildet. Das Magnetfeld des hängend eingebauten Chips zwingt dann die Atome in ein BEC, das nur wenige Mikrometer unterhalb seiner Oberfläche schwebt. Die Chipoberfläche hat dabei Raumtemperatur - aus Sicht des BEC eine Art heißer Herdplatte. Trotzdem bleibt es erfreulich stabil.
Nun probierten die Experimentatoren aus, was in ihrem Chip steckt. Im ersten Teil des Experiments transportierte ein magnetisches Förderband das BEC von links nach rechts. Im zweiten Teil schalteten die Physiker das Magnetfeld ab und ließen das Kondensat fallen. Die Wolke expandierte zwar während des Experiments, doch selbst während des Falls blieb das Kondensat lange erhalten. „Verdünnte Bose-Einstein-Kondensate sind mittlerweile gut verstanden“, resümiert Hänsch. Nun hält er BEC Wolken für besonders interessant, in denen die Atome sehr dicht beieinander schweben und sich gegenseitig stark beeinflussen. „Wenn wir das Verhalten von solchen Vielteilchensystemen beobachten, können wir noch eine ganze Menge lernen. Unsere Interpretation der Quantenmechanik wird sich möglicherweise stark verändern“, sagt der Wissenschaftler.
Inelastische Stöße beschleunigen Atome
Gerhard Rempe und seine Doktoranden Johannes Schuster, Andreas Marte und Bernhard Sang „wollen gerne Kondensate im hydrodynamischen Regime präparieren“. Damit meint Marte ein BEC, das eine gewisse Mindestgröße und Mindestdichte hat. In solchen Kondensaten stoßen Atome häufiger zusammen. Dabei gibt es eine besondere Art von Stößen, die „inelastischen Stöße“. Sie setzen eine zusätzliche Energie frei, welche die beteiligten Atome heftig beschleunigt. Wenn das BEC klein ist, verlassen diese schnellen Atome die Gaswolke ohne weitere Zusammenstöße. In einem großen, dichten BEC kann jedoch eine Art „Kettenreaktion ablaufen - aber in der Energieskala ganz, ganz unten“, so Rempe. Diese Kettenreaktion hat natürlich nichts mit der Kettenreaktion zu tun, die durch eine Kernspaltung ausgelöst werden kann.
Die plötzlichen „Energieausbrüche“ der inelastischen Stöße verursacht das Innenleben der Atome, das aus Elektronen und Kern besteht. Äußerlich sind die Atome - Rempes Gruppe arbeitet mit Rubidium - zwar ultrakalt. Doch wenn zufällig drei Atome zusammenstoßen, können sie ein Molekül bilden. Das setzt eine Energie frei, die der „Bindungsenergie“ des Moleküls entspricht. Sie beschleunigt die Stoßpartner auf Geschwindigkeiten, die der tausendfachen Temperatur des BECs entsprechen. Treffen diese „rasenden Atome“ auf genügend andere Atome, so lösen sie eine „kalte Kettenreaktion“ aus, die weitere Atome aus dem BEC herauskickt. In einem BEC aus vielen Millionen Rubidium-Atomen identifizierte Rempes Gruppe lawinenartige Ereignisse, die auf solchen „kalten Kettenreaktionen“ beruhen.
Bauteile für den „Quantencomputer“
Die ultrakalte Quantenwelt der Bose-Einstein-Kondensate hält sicher noch manche Überraschung bereit. Als Anfang der sechziger Jahre die ersten Rubinlaser kurze Lichtblitze produzierten, spekulierten viele über neue Strahlenwaffen. Sie sind bis heute Science-Fiction geblieben. Dafür ist der Laser zur friedlichen Alltagstechnik geworden: Ohne ihn gäbe es keine CD-Spieler und -Brenner, keine optische Nachrichtenübertragung oder Lasermedizin. Was wird uns die Bose-Einstein-Kondensation bringen? Die Forscherfantasien reichen schon von kleinen, extrem empfindlichen Navigationsgeräten über tragbare Atomuhren bis zu Bauteilen für den „Quantencomputer“. Vielleicht werden die ultrakalten Quanten-Ensembles aus dem Alltag unserer Enkel nicht mehr wegzudenken sein.
Den Nobelpreis 2001 erhielten drei Pioniere der Bose-Einstein-Kondensation: Wolfgang Ketterle vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), sowie Eric A. Cornell und Carl E. Wieman von der University of Colorado (Boulder). Zwei der Nobelpreisträger haben enge persönliche Beziehungen zum Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Wolfgang Ketterles Doktorvater ist Herbert Walther, Direktor der Abteilung für Laserphysik und Professor an der Ludwig- Maximilians-Universität München. Carl E. Wiemans Doktorarbeit betreute Theodor W. Hänsch, während beide in den siebziger Jahren an der Universität von Stanford forschten.
Quelle: https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/atome-und-molekuele/atome-und-quantenphysik/das-quantenorchester/